...und anarchosyndikalistische Ansätze einer Stadtteilorganisation
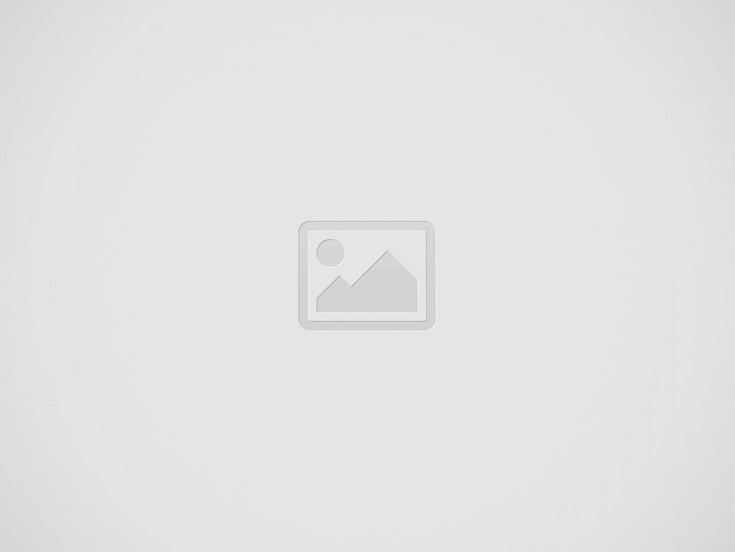
Wenn wir unsere Arbeitskraft im Betrieb verkaufen, so ist den meisten von uns klar, dass wir diese Arbeit nicht etwa für uns oder für das Allgemeinwohl leisten. Was wir von den Waren und Dienstleistungen halten die wir produzieren, interessiert unsere ArbeitgeberInnen herzlich wenig. Wir haben keine oder nur minimale Mitbestimmungsrechte was Art, Verwendung und Beschaffenheit der von uns produzierten Güter betrifft. Ebenso gehört das, was wir geschaffen haben, nicht uns. Die Arbeit hat mit uns als Personen quasi nichts zu tun. Ebenso verhält es sich mit den meisten Gütern die wir konsumieren. Wir wissen nicht wer sie hergestellt hat, haben zu dem Produkt und denen die es geschaffen haben, keinerlei greifbare Beziehung.
Da auch die einzelnen Bestandteile der Stadt Waren sind, setzt sich diese Entfremdung in ihr fort. Weder die ArbeiterInnen, die ihre Bestandteile herstellen und pflegen, noch die lohnabhängigen1 „KonsumentInnen“, also die BewohnerInnen, haben wirklichen Anteil an ihrer Gestaltung, Nutzung und Entwicklung.
Über unser Lebensumfeld entscheiden vordergründig Kapitalverhältnisse. Faktoren wie die Nähe zur Arbeit, Schule, Mietkosten, Bedingungen der VermieterInnen und vorhandene Angebote auf dem Wohnungsmarkt spielen bei der Wahl unseres Wohnumfeldes i.d.R. eine weitaus größere Rolle als die Frage nach der Nachbarschaft, unseren privaten Vorlieben und den Gestaltungsmöglichkeiten im Stadtteil. NachbarInnen bleiben meist unbekannt, Eigenheiten und Vorgänge im Stadtteil bekommen wir nur am Rande mit.
In unseren Mietwohnungen werden uns Wohnstandards, Haus- und Grundstücksregeln meist von der Vermietung diktiert. Kreative Gestaltung oder die freie Aushandlung von Normen des Zusammenlebens sind Luxus, der sich meist nur mit einem hohen Einkommen finanzieren lässt.
Ebenso verhält es sich mit unserem erweiterten Wohnumfeld. Die Gestaltung städtischer Flächen, die Straßenführung, die Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen wird in den Stadtparlamenten oft kurzfristig und hinter verschlossener Tür entschieden. Wollen Nachbarschaften Einspruch gegen unliebsame Bauprojekte o.ä. Erheben, benötigen sie meist zu viel Zeit um sich zu organisieren und sich im Ränkespiel zwischen Paragraphendschungel, Vertröstungen und gespielter Bürgerbeteiligung zurechtzufinden. In dieser Zeit werden von Investoren und Stadtregierungen gerne unumkehrbare Tatsachen geschaffen. Wenn es um private Grundstücke und Immobilien geht, ist die Ohnmacht noch größer – wer das Geld hat, hat die Macht, wer keins hat, hat Pech.
Der Mensch in der modernen kapitalistischen Stadt ist ein atomisiertes Individuum, das von den herrschenden Verhältnissen im Gefühl der Ohnmacht und Beziehungslosigkeit gehalten wird.
Doch auch die konkrete Ästhetik der Stadt spricht die Sprache der kompletten Kapitalisierung des urbanen Zusammenlebens. Öffentlicher Raum, das kann der Ort für Gestaltung, Kreativität und urbane Kommunikation sein. Faktisch ist Stadt heute aber in Struktur gegossene Sprachlosigkeit, oder besser: Die Kapitalseite spricht, der Rest hat die Fresse zu halten. Fassaden, Parks, Gehsteige – alles hat nach geschriebenen und ungeschriebenen Gesetzen glatt und normiert auszusehen. Eine Innenstadt, ein Vorort, eine Plattenbausiedlung, ein Gründerzeitviertel etc. sieht aus wie viele andere. Abwechslung bringen meist nur historische Prunkbauten und Prestigeobjekte. Die Kapitalseite spricht. Was fehlt, ist Platz für verwilderte Flächen, für Orte und Häuser, die NachbarInnen einfach nach ihren Bedürfnissen gestalten können. Was sich in der Stadt ablesen lässt: Die neuesten Konsumangebote, die ungefähre Preislage der Wohnungen, der aktuell angesagte Pastellton unter Baufrauen/-herren, vielleicht die Zuzugsrate. Was sich nicht ablesen lässt: Wer sind die BewohnerInnen der Häuser, was denken sie, was finden sie schön? Was machen sie gerne?
Als eine Gegenbewegung zu dieser Entpersonalisierung und der Entfremdung des Raumes können dagegen Graffiti und andere Formen von Streetart betrachtet werden. Mit der illegalen Handlung erhält die Stadt Merkmale, die mit der handelnden Person in Beziehung stehen. Auch kompensiert Streetart die Zentralisierung von öffentlicher Debatte, in dem sie oftmals politische Sachverhalte kommentiert oder in Frage stellt. Aber auch reiner Vandalismus ist sicher oft ein Ausdruck – wenn wohl auch meist unbestimmter – Rebellion gegen die Machtlosigkeit und Entfremdung des/der Handelnden. So gesehen bilden Zerstörung und Neugestaltung des urbanen Erscheinungsbilds die wohl am weitesten verbreitete direkte Aktion gegen die heutigen politischen Verhältnisse.
Gerade im Hinblick auf urbane räumliche Gestaltung zeigt sich, wie stark der menschliche Drang nach Selbstgestaltung und -bestimmung ist. Kinder, die in der Stadt aufwachsen, spielen wie selbstverständlich auf verwilderten Grünflächen und heruntergekommenen Ruinen, bauen sich eigene Refugien, schaffen Räume der Selbstbestimmung und der kreativen Verwirklichung. Das etwas Schlimmes daran sein könnte ein Stückchen Welt zu benutzen, müssen Eltern, Schule und Staat erst noch in ihre Köpfe hämmern. Auch in der Jugend setzt sich dieses Phänomen oft in Form von stillen Hausbesetzungen fort. Was meist als Treffpunkt zur Erlangung jugendlicher Autonomie beginnt, weitet sich immer wieder zu Wohnbesetzungen junger Menschen aus. Der Regelübertritt geschieht hier meist bewusst, mal aus Protest, mal aus Freude am Kitzel, mal aus der Selbstverständlichkeit heraus, dass die heutigen Besitzverhältnisse eine ungerechte Absurdität sind.
Erscheinungen dieser mehr oder weniger politisch motivierten Regelübertritte im Ringen um Selbstbestimmung und freie Nutzung der Stadt ließen sich noch viele finden, z.B. die Umgestaltung von Grünflächen, spontane Happenings im Park, Feiern in leerstehenden Industrieruinen, öffentliche Hausbesetzungen usw. Meist verhindern jedoch der mangelnde Rückhalt in der NachbarInnenschaft, die massive städtische und staatliche Repression oder der von Beginn an temporäre Charakter dieser Aktionen nachhaltige Veränderungen.
Konkrete Ansätze, wie es über den Rahmen einzelner linker Hausprojekte oder Wagenplätze hinaus möglich ist, sich gemeinsam zu organisieren, bietet ein Blick in einen Teil des Dresdner Stadtteils Löbtau. Schon vor Jahren waren hier unabhängig voneinander ein selbstverwaltetes Studierendenheim, ein linkes Hausprojekt und kostengünstige ArbeiterInnen-WGs entstanden. Seit 2009 häuften sich Auseinandersetzungen mit FaschistInnen, die auch immer wieder BewohnerInnen des Viertels attackierten. 2011 gipfelte die rechte Gewalt in einem Angriff von 250 FaschistInnen auf insgesamt vier Häuser der Nachbarschaft. Dieser bittere Anlass ließ die NachbarInnen näher zusammenrücken. Am Tag danach wurden die gröbsten Schäden zusammen beseitigt und eine erste NachbarInnenversammlung einberufen.
Mittlerweile entwickelte sich daraus ein NachbarInnennetzwerk aus über hundert Menschen, die sich kennen und mal mehr, mal weniger miteinander kooperieren. Aus den verschiedenen Kreisen entwickelten sich kulturelle und politische Veranstaltungsreihen, DIY-Angebote, zwei kollektiv genutzte Gärten, eine selbstgebaute Nachbarschaftssauna, ein Emailverteiler, um Termine, politische und soziale Geschehnisse bekannt zu geben, aber auch Zimmer- und Wohnungssuche zu koordinieren. Immer wieder wurden dabei selbstverständlich Mittel der direkten Aktion genutzt und nicht nach Gesetz, sondern nach moralischer Beurteilung gehandelt. Daneben wirkt sich die soziale Vernetzung der NachbarInnen auch in alltäglicher Hilfe und einem verbesserten Klima aus. Der wichtigste Fortschritt ist aber vielleicht der, dass progressive MitarbeiterInnen des Grünflächen- und Stadtplanungsamts das Plenum und die Einzelpersonen der Nachbarschaftsvernetzung als Verhandlungspartner zur Neugestaltung von Flächen im Stadtteil anerkannt haben. So wird aktuell die zweite Fläche nach den Wünschen der NachbarInnen gestaltet, und es konnten halbwilde Grünflächen, eine Streuobstwiese, Hängematten, Graffitiwände und mehr durchgesetzt werden.
Die FAU ist heute noch keine große Gewerkschaftsföderation und ist gezwungen, sich vor allem auf gewerkschaftliche Kernaufgaben des Arbeitskampfs zu konzentrieren, um an Breite, Bekanntheit und Wirkmacht zu gewinnen. Das Konzept anarchosyndikalistischer Organisation bedeutete aber schon immer mehr als den reinen Kampf in der kapitalistischen Produktion. Nach dem Konzept der Arbeiterbörsen haben die lokalen FAU-Gewerkschaftstrukturen langfristig auch die Aufgabe, alle anderen gesellschaftlichen Belange zu organisieren oder mit anderen emanzipatorischen Initiativen in diesem Sinne Hand in Hand zusammenzuarbeiten.
In den Nachbarschaften kann die FAU in diesem Sinne z.B. Strukturen aufbauen, um die aktive Selbstorganisation der BewohnerInnen zu fördern. Praktisch kann dies zum Beispiel in der Schaffung von Nachbarschaftsinformationsbüros geschehen, die nicht nur gewerkschaftliche Beratungen anbieten, sondern ebenso Angebot und Nachfrage für ehrenamtliche Pflege- und Hausarbeiten vermitteln. Mit eigenen Fonds könnte die Schaffung von sozialverträglichen und kollektiv organisierten Wohn- und Arbeitsräumen in Angriff genommen werden, Grünflächen unter Verwaltung der AnwohnerInnen gebracht werden usw.2 Ebenso könnten in den Nachbarschaften mit Hilfe der FAU Umsonstläden und Vertriebskollektive für kollektiv produzierte Waren3, soziale Zentren, freie Kindertagesstätten usw. entstehen. Sicher sind auch hier der Ausbreitung durch die Kapitalverhältnisse starke Grenzen gesetzt. Doch schon heutige Beispiele zeigen, dass bundesweit und international föderierte Strukturen finanziell und politisch um ein vielfaches schlagkräftiger sind als zufällig vernetzte Einzelinitiativen. Schließlich ermöglicht jede weitere selbstkritisch-kollektive Struktur neue Freiräume, um Konzepte der Selbstverwaltung und partiell auch der Schenkwirtschaft zu erproben, in Frage zu stellen und zu optimieren und so die komplette Übernahme aller gesellschaftlichen Belange in Selbstverwaltung ein bisschen möglicher zu machen.
[1] ↑
Gemeint sind hier nicht nur Menschen in einem Lohnverhältnis, sondern
ebenso z.B. Menschen, die auf den Lohn von Angehörigen oder staatliche
Transferleistungen angewiesen sind.
[2] ↑
Siehe dazu das schon heute gut funktionierende Mietshäusersyndikat, das
Kollektiven bei der Schaffung selbstverwalteter Häuser und Flächen
rechtlich und finanziell hilft.
[3] ↑ Siehe Artikel zum Konzept „Gewerkschaftlich organisierter Betrieb“ („Geiles Label sucht cooles Kollektiv“ DA 218)
Ein Start für eine Diskussion um Lohnmodelle in Basisgewerkschaften, Kollektivbetrieben und Betriebsgruppen.
"Cyankali" - Ein haarsträubend aktuelles Werk über Abtreibungen aus der Weimarer Republik wurde erstmals in…
Interview mit Torsten Bewernitz und Gabriel Kuhn.
Der revolutionäre Syndikalismus, wie wir ihn kennen, gehört vielleicht der Vergangenheit an. Damit er überleben…
Rezension zum Buch der Sanktionsfrei e.V. Gründerinnen über Bürgergeld, Armut und Reichtum.
Kommentare