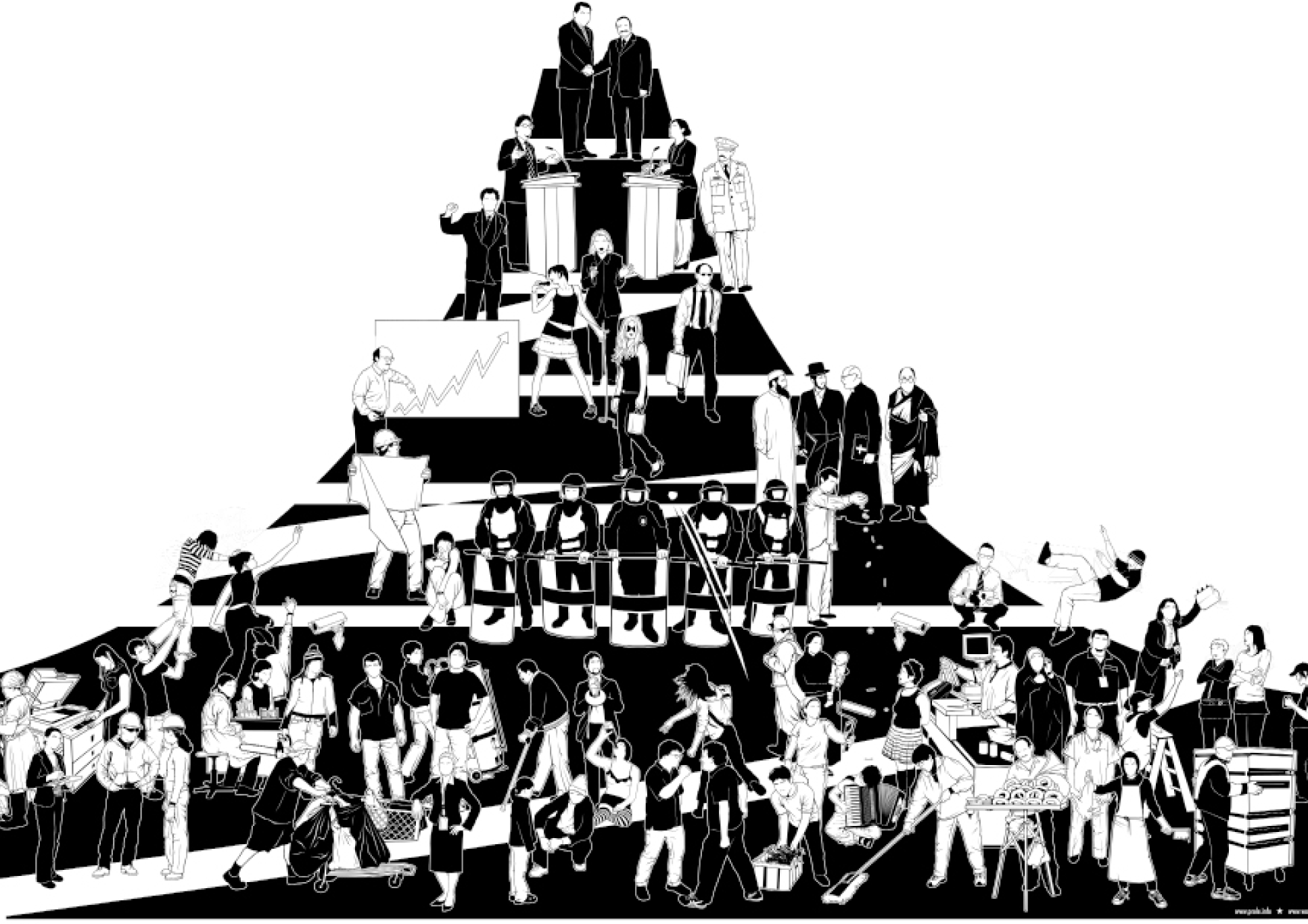 Es könnte packendes Kino sein: Digital boys mit bewaffneten Pick-Ups im Wüstenkrieg, atomar verseuchte Küstenregionen, Klimawandel und Hungersnöte, brennende Großstadtschluchten und Robocops an der Themse, irre Nazi-Terroristen und private Söldnerheere… Nun scheinen doch jene dystopischen Szenarien fast Wirklichkeit geworden zu sein, die in den 80ern das Bild der Zukunft prägten. Nichts war es mit dem „Ende der Geschichte“, das man lauthals in den 90ern verkündete, jenem Jahrzehnt, als die Zukunft gern als High-Tech-Schlaraffenland gemalt, als der Neoliberalismus zum religiösen Heilsversprechen wurde.
Es könnte packendes Kino sein: Digital boys mit bewaffneten Pick-Ups im Wüstenkrieg, atomar verseuchte Küstenregionen, Klimawandel und Hungersnöte, brennende Großstadtschluchten und Robocops an der Themse, irre Nazi-Terroristen und private Söldnerheere… Nun scheinen doch jene dystopischen Szenarien fast Wirklichkeit geworden zu sein, die in den 80ern das Bild der Zukunft prägten. Nichts war es mit dem „Ende der Geschichte“, das man lauthals in den 90ern verkündete, jenem Jahrzehnt, als die Zukunft gern als High-Tech-Schlaraffenland gemalt, als der Neoliberalismus zum religiösen Heilsversprechen wurde.
Vergangen sind fast drei Jahrzehnte, in denen geplündert und verteilt wurde, von unten nach oben, versteht sich, erst zögerlich, dann immer dreister. Zurück blieben Schneisen der Verarmung, soziale Verwüstungen – und Menschen, denen unter dem geistesbetäubenden Geschrei des Marktfundamentalismus der plumpe Kampfruf des Neoliberalismus zur eigenen Gewissheit geworden ist: „Es gibt keine Alternative“. Doch jetzt geht es nicht mehr nur um abgeschriebene Existenzen, jetzt beginnen ganze Gesellschaften instabil zu werden. Der Kampf um Ressourcen, Teilhabe und Mitsprache ist eröffnet.
Klassenkampf ist nichts Romantisierendes, er ist ein Resultat der komplexen Verhältnisse, in denen die Akteure nach wie vor ihre Rolle spielen – nur allzu perfekt. Dass der Fehler im berüchtigten „System“ liegt, entgeht mittlerweile kaum jemandem. „Hat die Linke nicht am Ende Recht?“, fragte sich unlängst Charles Moore, konservativer Publizist und Biograph Margaret Thatchers, angesichts der sozialen Verrohungen und Widersprüche, die der sog. „freie Markt“ erzeugt – und löste damit eine kleine „bürgerliche Systemdebatte“ aus. Auch den Regierungen fällt es immer schwerer, ein Spiel schmackhaft zu machen, dessen Betrugsmaschen offensichtlich sind. Etwa wenn die Verschiebung fiktiver Größen und ein paar Rating-Buchstaben solch gewaltige Auswirkungen auf reale Wirtschaftsleistungen haben. Oder wenn die unter erhobenem Zeigefinger gewährte Hilfe für die „Pleite-Griechen“ in Wirklichkeit direkt in die Banken fließt. Doch trotz der offen liegenden Verteilungsmechanismen und des nackten Schwindels wird im Protokoll fortgefahren, rattert die Umverteilungsmaschinerie weiter. Ökonomie ist eben kein moralisches Feld, sondern eine Frage von Interessen, von Besitz- und Machtverhältnissen.
Sollte man wirklich überrascht sein, dass gesteigerte Konkurrenz nicht nur Gewinner, sondern auch Verliererinnen hervorbringt, dass zunehmendes Gewinnstreben zu höherer Ausbeutung führt, dass die Anhäufung von Reichtum in der Breite Armut erzeugt, und dass Individualisierung, Leistungsdruck und Hetze soziale Verrohung bedeuten? Insofern war die neoliberale Vision schon immer eine Gesellschaft von Asozialen. Wer nun erschrocken über die Auswirkungen seiner Predigten ist, hatte sich wohl vorher nie selbst zugehört. Frank Schirrmacher hat zwar Recht, wenn er in der FAZ feststellt, dass der Neoliberalismus nicht einfach „wie eine Gehirnwäsche über die Gesellschaft kam“. Er war aber auch keine diskursive Geschmacksverirrung, der man kollektiv auf den Leim gegangen ist, wie Schirrmacher anscheinend nahe legen möchte. Zumindest der kategorische Imperativ des Neoliberalismus war schon immer eine offene, wenn auch zynische Kriegserklärung an die Arbeiterklasse: Bereichert euch – zum Wohle aller! Selbstverständlich konnte diese Losung nur an jene gerichtet sein, die überhaupt über die Mittel verfügen, sich bereichern zu können. Dass binnen kürzester Zeit soziale Errungenschaften weggefegt wurden, für die einst viel Blut fließen musste, zeigt, welch explosives Ungleichgewicht den kapitalistischen Machtverhältnissen innewohnt.
Jene Errungenschaften waren nicht etwa einer Laune entsprungen. Der Siegeszug von Sozialstaat und Keynesianismus nach dem Zweiten Weltkrieg, die sog. „sozialdemokratische Epoche“, beruhte durchaus auf einem breiten bürgerlichen Konsens. Schließlich hatte die kapitalistische Krisenökonomie zuvor beträchtliche soziale Verwüstungen angerichtet, die nicht nur revolutionäre, sondern auch reaktionäre Bewegungen in die politische Arena treten ließen – ein Konflikt, dessen Dynamik sich letztlich auch auf staatlicher und internationaler Ebene ergießen sollte, mit der bekannten Katastrophe als Folge. Der Sozialstaat und die zumindest bedingte Einschränkung kapitalistischer Freiheiten waren die notwendige und kleinlaute Konzession für einen weiter tragbaren und relativ stabilen Kapitalismus.
So gesehen waren diese Errungenschaften auch weniger ein Erfolg der Arbeiterbewegung selbst, als ein Resultat des humanen Supergaus, in den sie durch die kapitalistischen Unzumutbarkeiten geworfen wurde. Bis zuletzt konnte sie dabei kein Patent gegen die herrschenden Kräfte entwickeln, um eine revolutionäre Veränderung im sozialen Sinne herbeizuführen. Vielfach forderten ihre Bemühungen nur reaktionäre Akteure heraus, die in diesen Auseinandersetzungen stärker wurden. Diese gaben nicht nur dem verängstigten Bürgertum Sicherheit, sondern erschienen auch vielen Systemverlierern als Alternative. Sie profitierten gewissermaßen von den revolutionären Bewegungen, etwa wenn diese selbst als Alternative für die Enttäuschten der Gesellschaft versagten oder Konfliktfronten schufen, an denen sich die Reaktion profilieren konnte. Auf derartige „Gefahren der Revolution“ hatten nicht zuletzt Syndikalisten wie Rudolf Rocker oder Alexander Schapiro mehrfach verwiesen.
Auch heute sollte man sich keine Illusionen über die Parameter sozialer Veränderung machen, wie es zuweilen bei den Debatten um die Krisenproteste wirkt, insbesondere unter dem Eindruck der Umbrüche in der arabischen Welt. Die Bedingungen sind doch gänzlich andere. Denn Autokratien und Diktaturen haben zwar eine große innere Stärke, wenn aber etwas aufbricht und die Masse sich gegen sie wendet, haben sie keinen Rückzugsraum mehr – außer der physischen Konfrontation. Insbesondere gilt dies für Libyen, wo im Staat nicht nur die politische, sondern wesentlich auch die wirtschaftliche Macht konzentriert liegt. Der politische Machtkampf ist hier inhärent auch ein Verteilungskampf, so dass der Staat in den ungeteilten Fokus sowohl bürgerlicher als auch sozialer Ansprüche gerät. Anders liegen die Konfliktfronten etwa in Ägypten und Tunesien, wo eine Synthese aus Bürgertum und ArbeiterInnen zwar relativ schnell autokratische Herrscher verjagen konnte, auf dem sozialen Feld, wo es um die substantiellen Verbesserungen geht, stehen die ArbeiterInnen jedoch alleine mit ihren Interessen.
Die „westlichen Demokratien“ sind da flexibler und v.a. breiter legitimiert, so dass sie Massenprotesten mit größerer Gelassenheit begegnen können, zumal hier ohnehin kein politischer regime change auf der Tagesordnung steht. Im Kern geht es vielmehr um Fragen der sozialen Gerechtigkeit, ein Konfliktfeld, das weitestgehend im Bereich der Ökonomie zu verorten ist, allzu gerne aber in den „Verantwortungsbereich“ des Staates projiziert wird. Die neuen sozialen Bewegungen sehen sich deshalb alle vor der dringenden Aufgabe, Mittel zu entwickeln, die auch wirkliche Erfolge auf diesem Gebiet versprechen und nicht in kontraproduktiven Konflikten mit dem Staat münden. Riots wie in England mögen sozial nachvollziehbar sein, sie sind aber gewiss kein Prozess der Ermächtigung. Sie sind der Ausdruck einer organisatorischen Schwäche und eines Mangel an Strategie, der sich nicht so einfach überwinden lässt. Vielmehr bietet es dem Staat die Möglichkeit, sich als Organisator von Sicherheit ein Stück seiner verlorenen Legitimität zurückzuholen und die Handlungsmöglichkeiten für soziale Ausbrüche einzuschränken.
Nicht anderes gilt für solche hotspots wie Griechenland oder Spanien. Selbst hier erfordert soziale Veränderung umfassendere Organisierungsbemühungen als bisher, wenn das strukturelle Machtungleichgewicht des Kapitalismus nur ansatzweise ins Wanken gebracht werden soll. Sonst bleibt die linke Losung „Wir zahlen nicht für eure Krise“ nichts als Mobilisierungsrhetorik und wird die Krisendynamik auf einer anderen Welle reiten. Erforderlich sind Ansätze, die nachhaltige Zäsuren ermöglichen und die Abhängigkeit vom Staat in der sozialen Frage mindern: Strukturen sozialer und wirtschaftlicher Gegenmacht. Durch solche verliert die offizielle Politik ihre Legitimität als vermeintliche Vermittlerin zwischen Sozialem und Wirtschaftlichem – und gerät zudem unter viel stärkeren Handlungsdruck. Zugleich müssen die reaktionären Potentiale im dynamischen Zusammenspiel von Krise und Bewegung stets in den eigenen Strategien mitgedacht werden. Dann könnte die Krise auch eine soziale Chance sein.
